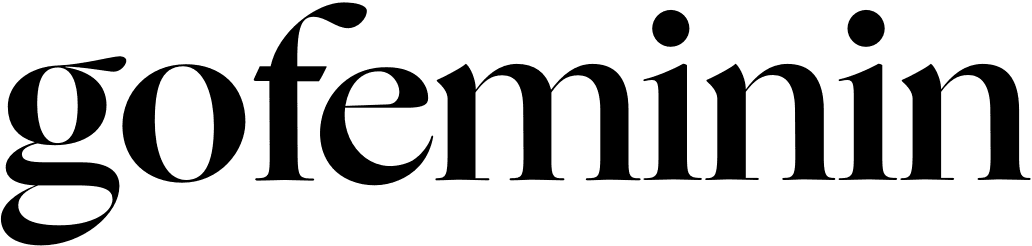Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Jeder Erwachsene über 18 Jahre mit einem deutschen Pass hat dann die Möglichkeit, aktiv auf die Politik einzuwirken und die Zusammensetzung des Deutschen Bundestags mitzubestimmen.
Aber nicht jede*r wird seine Chance nutzen. Und das muss gar nichts mit Politikverdrossenheit, Unmut oder Protest zu tun haben, sondern liegt oft an Unsicherheiten und manchmal schlichtweg an Unwissenheit.
Ich war in der Vergangenheit bei Wahlen als Wahlhelferin im Einsatz. Dabei konnte ich zuhauf beobachten, wie unsicher und unwissend Menschen sind, wenn es darum geht, zu wählen. Versteht mich nicht falsch, denn diese Menschen sind ins Wahlbüro gekommen, trotz ihrer Unsicherheiten. Ihnen gebührt im Namen der Demokratie also großer Dank.
Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass viele andere Menschen, die genauso oder sogar noch unsicherer sind, genau aus diesem Grund nicht zur Wahl erschienen sind und ihre Stimmen haben verfallen lassen.
Und diese Menschen werden auch zur bevorstehenden Bundestagswahl am 23. Februar 2025 nicht erscheinen. Angesichts aktueller politischer Entwicklungen eine gruselige Vorstellung. Denn jede nicht abgegeben Stimme ist im Zweifel eine Stimme gegen die Demokratie.
Juniorwahl gibt Sicherheit bei Wahlen
Deshalb ist es wichtig, dass bereits Kinder lernen, wie man wählt und wie wichtig ihre (spätere erwachsene) Stimme ist. Die Stimme jedes und jeder einzelnen. Und genau an der Stelle kommt die Juniorwahl ins Spiel, bei der Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse die Möglichkeit haben, ihre Stimme abzugeben und so ein Gefühl für den Wahlprozess und die Bedeutung der Demokratie zu entwickeln.
Die Juniorwahl findet bundesweit in allen 299 Wahlkreisen an allen Schulformen der Sekundarstufen I und II sowie berufliche Schulen statt. -> Hier findet ihr mehr Infos zur Juniorwahl 2025.
Es geht nicht nur darum, eine Wahl zu simulieren, sondern darum, dass die Schüler*innen verstehen, wie wichtig ihre Stimme in einer Demokratie ist, auch wenn sie gerade noch nicht wählen dürfen. So können sie die Mechanismen des Wahlrechts und der politischen Entscheidungsfindung kennenlernen, was sie hoffentlich zu informierten und engagierten Bürger*innen in der Zukunft macht.
Um Schülerinnen und Schüler davon zu überzeugen, die Juniorwahl ernst zu nehmen (und nicht aus Quatsch ihre Kreuze irgendwo zu machen), auch wenn sie keine direkten Auswirkungen auf die echte Bundestagswahl hat, sollten Lehrer*innen und Eltern ihnen zeigen, warum sie wichtig ist:
Bedeutung der Stimme betonen
Es ist wichtig, dass jede*r Wahlberechtigte, egal ob Juniorwahl oder echte Bundestagswahl, begreift, wie wichtig jede einzelne Stimme ist. Eine einfache mathematische Darstellung, wie bei einer Wahl die Stimmen in Prozent umgerechnet werden und was es bedeutet, wenn zum Beispiel 1 % der Stimmen den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmacht, kann Schüler*innen helfen und das Konzept greifbarer machen.
Dabei sollte auch unbedingt auf die Wahlbeteiligung eingegangen werden und wie sich diese auf das Gesamtbild der Wahl auswirkt. Je mehr Menschen wählen, desto klarer wird das Ergebnis. Und je weniger Menschen wählen, umso einfacher haben es antidemokratische Parteien, Erfolge zu feiern.
Zukunftsperspektive aufzeigen
Man sollte Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam machen, dass Wahlen nicht nur ein einmaliges Ereignis sind, sondern dass sie immer Auswirkungen auf die Zukunft haben. Zum Beispiel könnten sie erfahren, wie politische Entscheidungen ihre Schulbildung, den Klimaschutz oder die Sozialpolitik betreffen können. So merken sie, dass eine Stimme nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft zählt.
Bedeutung der demokratischen Verantwortung betonen
Wer nicht wählen geht, überlässt anderen die Entscheidungen über die Zukunft und eben auch über die eigene Zukunft. Das mag in der Politik nicht immer sofort ersichtlich werden, kann aber im kleinen Rahmen anhand des Klassenverbands und sogar innerhalb der Familie verdeutlicht werden.
Verbindung zur realen Politik herstellen
Die Juniorwahl ist eine sehr gute Abbildung der echten Wahl und die Ergebnisse werden von Medien und Politikern verfolgt. Die Ergebnisse der Juniorwahlen sollten unbedingt mit den Ergebnissen der echten Wahl verglichen werden, damit Schüler*innen sehen können, wie nah ihre Wahlentscheidungen denen der Erwachsenen kommen und wo sich vielleicht Unterschiede zeigen.
Mitbestimmung hervorheben
Schülerinnen und Schüler sollten in Diskussionen eingebunden werden, warum politische Entscheidungen wichtig sind und wie diese ihr Leben beeinflussen können. Indem man aufzeigt, dass politische Themen auch für ihre Generation relevant sind – zum Beispiel in Bezug auf Bildung, Klima oder soziale Gerechtigkeit – könnten sie motiviert werden, ihre Wahl ernst zu nehmen.
Lernen durch Beteiligung
Das praktische Erleben einer Wahl, die Vorbereitung auf das Wählen und die Auseinandersetzung mit den Themen gibt Schülerinnen und Schülern eine aktive Rolle in der Demokratie. So sehen sie selbst, dass Wahlen mehr sind als nur das Abstimmen; es geht darum, informiert zu sein und Verantwortung zu übernehmen.
Schüler*innen können Multiplikatoren sein
Durch Gespräche über die bevorstehende Wahl mit Eltern, Lehrer*innen, Geschwistern, Verwandten, Nachbarn und Bekannten können Schüler*innen eine Brücke schlagen, die ihnen die Bedeutung der Wahl unmittelbar aufzeigt.
Gleichzeitig sorgen sie dafür, unbeteiligtere Personen zu animieren, sich selbst zu informieren und eben wählen zu gehen. Winkt Tante Lotte oder Onkel Bernd also mal wieder ab, wenn es um die Wahlen geht, kann man auch mal sein Kind vorschieben, das beiden dann die Hölle heiß macht, gefälligst ihre Kreuze zu setzen.
Hat euer Kind mit seinem Zeugnis schon seinen Wahlschein erhalten? Dann setzt euch direkt heute zusammen hin, beantwortet die Fragen des Wahl-O-Mat oder Real-O-Mat (oder beide) und sprecht über die aktuelle politische Lage. Ihr werdet staunen, was euer Kind alles weiß.
>> Und denk immer daran: Wählen bedeutet Mitbestimmung! Mach dich schlau und geh am 23. Februar 2025 zur Bundestagswahl – für eine starke und gerechte Zukunft. <<
Weitere Themen:
- Demokratie in Gefahr? Warum Schülerinnen und Schüler jetzt schon Wählen lernen sollten
- Unperfekte Erziehung: Warum „Gut genug“ für unsere Kinder perfekt ist
- Erziehung: Das brauchen Kinder zwischen 9 und 12 Jahren von ihren Eltern
- Erziehung in der Pubertät: Typische Elternsätze, die Teenager verletzen