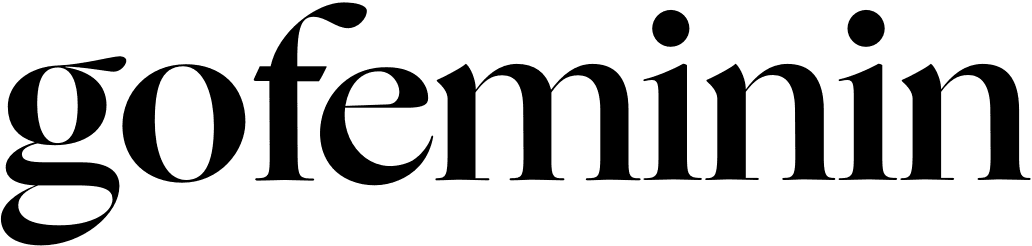Es ist immer müßig, wenn sich Erwachsene aufmachen, um eine Aussage über die „heutige Jugend“ zu machen. Dann kriegt sie meist einen faden Stempel, einen Namen wie Generation X oder Y und wird mit den Generationen vor ihr verglichen. Meist schneidet die aktuelle Generation junger Menschen nicht besonders gut ab. Zu kritisieren gibt es scheinbar immer etwas.
Nichtsdestotrotz ist es spannend zu sehen, wie sich eine Generation von der nächsten unterscheidet. Selbst wenn Studien nur eine Tendenz oder einen Mittelwert erfassen können.
Schuld an den Generations-Etiketten ist übrigens der kanadische Buchautor Douglas Coupland, der 1991 mit seinem Roman „Generation X“ den Jugendlichen seines Jahrzehnts ein Etikett verpasste. Und weil nach X nicht mehr viel kommt außer Y und Z, ging man irgendwann dazu über, jeder Generation ein einprägsames Maskottchen mit auf den Weg zu geben. „Generation Golf“ (nach Florian Illies gleichnamigem Buch), „Generation Ally“ (nach Katja Kullmanns Buch in Anlehnung an die Serienheldin Ally McBeal), „Generation Maybe“, „Generation Praktikum“.
Was ist dran an der Generation Y?
Die derzeitige Jugend hat einen der letzten Buchstaben abbekommen. Mit Generation Y bezeichnet man diejenigen, die heute ungefähr zwischen 20 und 30 Jahren alt sind (wobei die genaue Definition der Geburtsjahre weltweit recht unterschiedlich ist). Dabei wird das Y englisch wie „why“, also „warum“, ausgesprochen, weil dieser Generation nachgesagt wird, dass sie alles hinterfragt.
Das zumindest besagen Studien, wie beispielsweise die des Sinus-Instituts. Und die sind zum Teil wenig charmant. Generation Mainstream wird die Jugend da genannt. Die, die in der Gemeinschaft abtauchen will, anpassungsfreudig, leistungsorientiert und familienaffin ist. Das klingt ziemlich brav. So gar nicht nach Jugend, Rebellion und Aufbegehren.

Aber genau das hat auch seine Gründe. Die Terroranschläge von New York, die Krisenherde dieser Welt – die Generation Y ist aufgewachsen in einer äußerst unsicheren Welt. Sie hat gelernt damit umzugehen, in schwierigen Situationen zu improvisieren und das beste daraus zu machen. Denn das Leben ist weniger geradlinig und planbar als früher. Ein Job auf Lebenszeit, wie ihn die Eltern hatten, ist utopisch. Die Rente ist ebenso unsicher wie die Zukunft. Das ist stressig, gibt aber auch ein Gefühl von Freiheit.
Für all diese Unsicherheiten schafft sich die Generation Y ein gutes Rüstzeug: Auf eine gute Bildung legt sie Wert, macht Abitur, füllt die Unis. Zumindest hat sie sich damit abgefunden, dass sie den steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden muss. Ihre Qualifikationen machen die Generation Y im Umkehrschluss aber auch recht selbstbewusst: Wenn sie ins Berufsleben starten, stellen sie Forderungen, zeigen sich selbstbewusst – sie wissen, was sie wollen: Eine Arbeit, die erfüllend ist, eine ordentliche Balance zwischen Arbeit und Freizeit, flexible Arbeitszeiten, Perspektiven.
Wild Feiern und Saufen tun sie hingegen nicht. Laut einer Studie des amerikanischen „Higher Education Research Institute“ tranken im Jahr 1981 durchschnittlich drei Viertel aller Studenten Bier und feierten. Bei der heutigen Jugend ist es nur noch ein Viertel. Auch der Zigarettenkonsum ist bei den Jugendlichen auf dem Tiefstand.

Die Jugendlichen der Generation Y werden auch Millennials genannt, weil sie die ersten Digital Natives sind, also eine Generation, die mit den heutigen Technologien, wie Computer, Internet, Mobiltelefon und MP3-Player, ganz selbstverständlich aufgewachsen ist (weshalb sie auch die Generation der Anglizismen sind). Sie sind vernetzt und dauer-online – und das von Kindesbeinen an.
Das Smartphone im Daueranschlag vor der Nase. Ständig wird irgendwas gesnappt oder gepostet. Kaum ein Latte oder ein Döner, der ungepostet in den Magen seines Besitzers darf. Fast alle besitzen ein Social-Media-Leben, in dem sie sich selbst darstellen. Meist mehr so, wie man es sich erträumt, als so, wie man wirklich ist.
Denn das strahlend helle Instagram-Leben fördert Begehrlichkeiten: Die Generation Y will sich selbstverwirklichen wie kaum eine Generation vor ihr. Schuld ist eben dieses ganze Präsentieren auf Instagram, Facebook & Co. Mein Style, meine Wohnung, meine Reisen, meine Freiheit, mein Hipnessfaktor. Sieht man das scheinbar perfekte Leben der anderen, kommt man glatt in Zugzwang.
Und so träumen die Millennials zwar davon, individuell zu sein. Doch vor lauter Besonders-sein laufen alle irgendwann uniform und gleich rum. Aus der Rolle zu fallen, aufzufallen ist längst zur Mission impossible geworden. Kaum ein Trend, der lange alternativ und underdog ist. Kaum wird es in den sozialen Netzwerken verbreitet, wird es von der Industrie aufgegriffen und somit Mainstream. Hipster ist längst ein Schimpfwort. Blogger werden von Firmen gepusht. Provokation ist ein Wort aus den 80ern.
Auch in der Liebe tun sich die Ypsiloner schwer. Auf Tinder wird der Lieblingsmensch fürs Leben gesucht, um dann doch wieder zu kneifen und weiterzusuchen. Dabei wollen sie alle gemocht und gebraucht werden. Sie suchen jemanden, der den Alltag mit ihnen teilt.
Bleibt nur zu hoffen, dass es ganz viele bunte Hunde unter den Millennials gibt, die in diesen Studien nicht auftauchen. Die rausfallen aus dem Raster, das man der Generation Y aufzudrücken versucht.